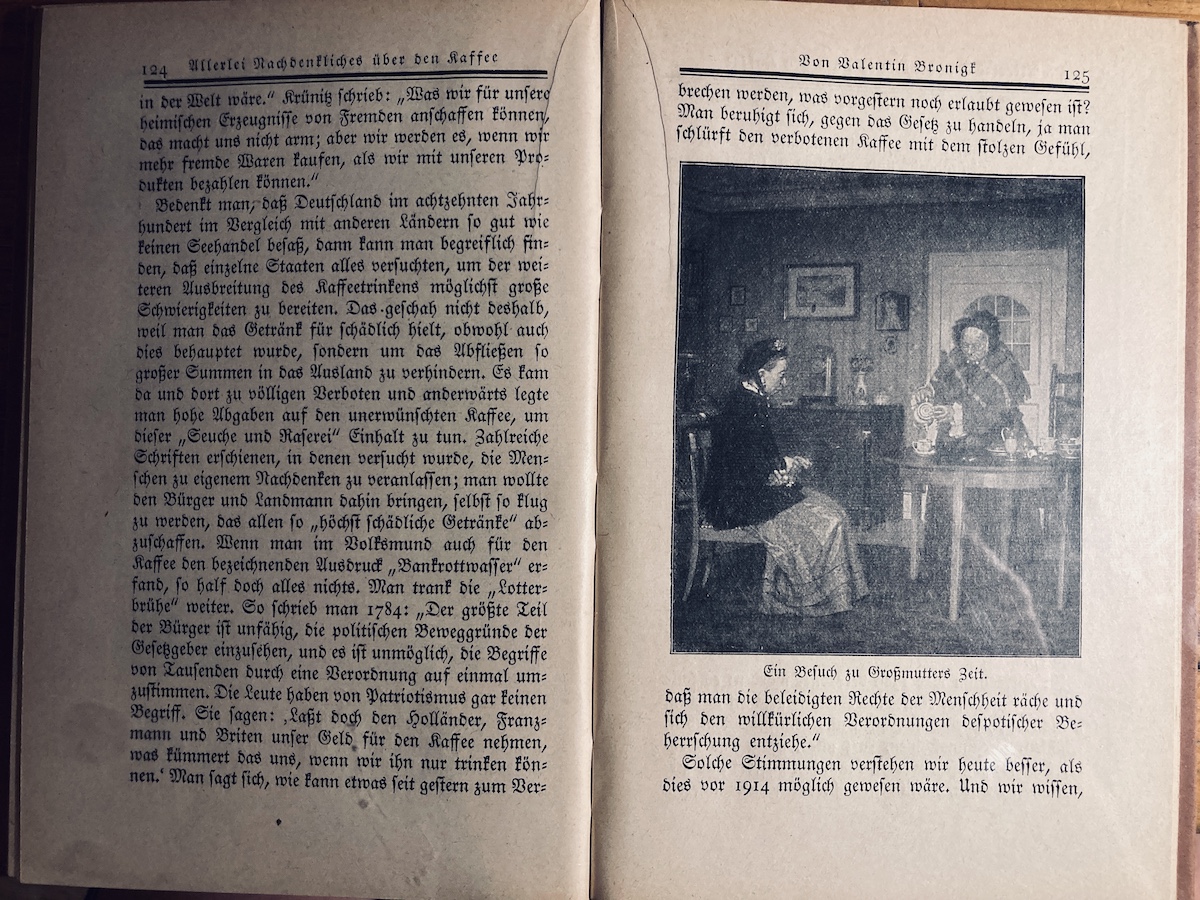Dieser Artikel ist eine wörtliche, unverfälschte Transkription des Originalartikels aus dem Jahre 1922.
Aus heutiger Sicht ethisch fragwürdige Ausdrucksweisen und Inhalte, sowie variierende Rechtschreibung sind nicht ausgeschlossen, wurden aber zwecks Authentizität nicht zensiert.
Allerlei Nachdenkliches über den Kaffee
Von Valentin Bronigk / mit 13 Bildern / 1922
So manches, was unseren Großeltern bekannt war, scheint den Enkeln unentbehrlich, gleichviel ob es technische Neuerungen sind oder Nahrungs- und ganz besonders Genußmittel. Gewisse Genußmittel sind als solche seit Jahrtausenden bekannt, wenn sich auch in ihrer Zubereitung vieles änderte. Andere kamen erst später auf. So erinnerte man sich 1920 daran, daß vierhundert Jahre verflossen waren, seit die Spanier Kakao und Schokolade aus Mittelamerika in ihre Heimat einführten. Der aus China stammende Tee ist 1559 durch Portugiesen und Holländer nach Europa gebracht worden, aber erst seit 1610 begann er sich langsam den Markt zu erobern. Um 1660 genoß man ihn als „kostbares Getränk“ in Londoner Kaffeehäusern.
Die alten Mexikaner tranken Kakao, die Chinesen besteureten zu einer Zeit den Tee, als bei uns die ersten Städte entstanden, und in Arabien scheint der Kaffee, obwohl schon vorher beliebt, im fünfzehnten Jahrundert größere Verbreitung gefunden zu haben, wenn man ihn auch vorher noch nicht aus den sogenannten Bohnen, sondern aus den getrockneten Samenhüllen und dem inneren Häutchen, welches den Samen, die „Bohne“, umgibt, zubereitete. Daß man den Tee in China mit Steuern belegte, läßt darauf schließen, daß dieses Getränk als narkotisches Genußmittel angesehen wurde. Man kannte die schlafverscheuchende Wirkung dieses Getränkes und erzählte eine artige Geschichte der Entstehung der Teestaude. Ein buddhistischer Heiliger soll gelobt haben, sich des Schlafes zu enthalten. Da er aber doch, von Müdigkeit überwältigt, einschlief, schnitt er zur Sühne für das gebrochene Gelübde seine Augenlider ab und warf sie auf die Erden; aus ihnen erwuchs die schlafverscheuchende Teestaude.
So soll auch in Arabien ein frommer Mufti, Semal Eddin aus Aden gebürtig, auf einer Reise nach Adjam die schlafhemmende Wirkung des Kaffees kennen gelernt haben, und er empfahl diesen Trank den Derwischen, um sie während der Nacht im Gebete munter zu erhalten. Dies setzte sich bald weiter fort und griff auch in Mekka um sich, dem großen Zusammenkunftsort aller Anhänger der Lehre des Propheten.
In Arabien war im fünfzehneten Jahrhundert das Getränk in allen großen Städten beliebt. Da entstand 1511 in Mekka ein großer Meinungskampf für und wider den Kaffee; Ärzte und Gelehrte lagen sich in den Haaren, und einer der Kaffeegegner behauptete, das Getränk berausche wie der den Bekennern des Islam verbotene Wein. Man verlchte den Eiferer und erklärte, wenn er ein solches Urteil fälle, müsse er doch Wein genossen haben. Unbedachtsam gab dies der Muslim zu. Nun drehten die Fragen den Spieß um, und der Eilfertige erhielt die gesetzlich vorgeschriebene Stockprügel auf die Fußsohlen. Endlich führten die Streitigkeiten doch dazu, daß unter dem Statthalter Khair Bei ein Kaffeeverbot herauskam. Die Vorräte bei den Händlern wurde eingezogen und verbrannt. Wen man beim Kaffeetrinken ertappte, den traf hate Strafe; die Verächter des Gesetzes stzte man rückwärts aufgezäumt auf einen Esel und zog mit ihnen durch die Stadt. Das geschah zu dieser Zeit in Mekka.
In der Residenz Kairo aber waren Ärzte und Gelehrte anderer Meinung; der Sultan teilte die Auffassung dieser Männer und befahl dem Statthalter in Mekka, den schwarzen Trank freizugeben. Was man bekämpfte war weniger der Kaffee, sondern das Treiben an den Stätten, da man ihn ausschenkte; Spiel um Geld, musizieren, singen und tanzen hatte dort um sich gegriffen und Ärgernis erregt. Der Nachfolger Khair Beis trank selbst Kaffee, und so kam es, daß der Handel mit Bohnen und der Verkauf des Trankes nicht mehr behindert wurde.
Dreiundzwanzig Jahre nach diesen Streitigkeiten entstanden in Konstantinopel abermals heftige Auseinandersetzungen über den narkotsichen Trank. Dort waren zwei gut ausgestattete Kaffeehäuser entstanden, in denen sich Gelehrte, Dichter und andere Leute versammelten; man vertrieb sich leere Stunden mit Brettspielen, plauderte und verbrachte, ohne Geld auszugeben, in angenehmer Weise die Zeit. Personen aus allen Ständen, Serailbeamte, Paschas und Hofbedienstete von hohem Rang besuchten Kaffeehäuser. Da beklagten die Vorsteher der Moscheen dieses Treiben, weil man mehr Leute dort fände, als in den dem Dienste Allahs geweihten Stätten. Derwische prädigten öffentlich gegen diese neue Mode und behaupteten, es sei eine weit geringere Sünde, Wein zu trinken, als ein Kaffeehaus aufzusuchen. Im Verlauf der Streitigkeiten entschied die Geistlichkeit, nach dem Gesetz Mohammeds sei es nicht erlaubt, Kaffee zu genießen. Die Häuser, in denen der Trank verabreicht wurde, mussten geschlossen werden, und die Hüter der öffentlichen Ordnung erhielten den Befehl, jedermann anzuzeigen, der sich gegen den Erlaß verging.
Da man aber so gut wie nichts damit ausrichtete, gab man den Kaffeehandel gegen Erlegung gewisser Abgaben frei, verbot jedoch, ihn öffentlich zu trinken. Nun entstanden in Hinterzimmern und versteckt gelegenen Winkeln geheime Schankstellen und allmählich gab es mehr als zuvor. Die Besitzer solcher Kaffeehäuser mußten täglich eine Zechine an Abgaben bezahlen und durften doch nur einen geringen Preis für eine Tasse Kaffee fordern. Nun war der Friede hergestellt, aber es sollte zur Zeit Mohammeds IV. Noch einmal dazu kommen, daß die Kaffeehäuser in Konstantinopel geschlossen wurden.
Diesmal geschah es aus politischen Gründen, denn die Kaffeehausbesucher führten Gespräche, die staatsgefährlich erschienen. Nun half man sich auf andere Art; in kupfernen Kesseln bereiteter Kaffee wurde in Straßen und auf den Marktplätzen öffentlich verkauft. Aber auch in Familien fand das verpönte Getränk immer mehr Liebhaber. Orientalische Frauen betrachteten es als Grund zur Ehescheidung, wenn sie mit Kaffee nicht genügend bedacht wurden. Aus der reichhaltigen arabischen Literatur jener Zeit, die ebensoviel Spott- wie Lobgedichte auf den Kaffee enthält, läßt sich ersehen, mit welcher Erbitterung fortwährend um seine Verbreitung gerungen wurde.
Durch den venezianischen Seehandel kam der Kaffee zuerst nach Italien, wo er 1615 noch nicht sehr bekannt gewesen sein kann, denn der Reisende Pietro della Valle schrieb in jenem Jahre aus Konstantinopel einem Freunde, er werde ihm etwas Kaffee, der in Venedig noch unbekannt sei, mitbringen. Nach England und Frankreich gelangte der Kaffee um die Mitte des siebzehnten Jahrunderts, wo man ihn zuerst in den Hafenstädten trank; meist genossen ih dort Leute, die sich auf ihren Reisen nach der Levante daran gewöhnt hatten.
Daß man nicht überall verstand, den Kaffee richtig zu behandeln und das Getränk deshalb ablehnte, läßt sich denken. So hatte der Amsterdamer Großhändler von Smiten im Jahre 1637 seinem Geschäftsfreund Hervano in Merseburg eine Probe des „so schnell berühmt gewordenen Koffeyi“ gesandt und genau angegeben, wie der Trank zubereitet werden sollte. Frau Hervano schien es nicht richtig, den Kaffee nur mit Wasser zu kochen, und sie nahm Fleischbrühe dazu. Dieser Trank scheint den Mersenburgern nicht gut bekommen zu sein, denn nach einem Bericht darüber schrieb der holländische Händler entrüstet: „Ich habe Eure Pfefferbestellung erhalten, schicke Euch jedoch keinen, da ich auf eine Geschäftsverbindung verzichte, von welcher ich für meinen guten Willen nur Grobheiten hören muß. Wenn euer ganzes Personal nach Genuß dieses vorzüglichen Koffeyi krank geworden ist, und Ihr mir sechzehn gute Groschen für Abführmittel anrechnen wollt, so muß ich mir das ernstens verbitten. Ich habe schon fünf Ballen Koffeyi nach Leipzig verladen lassen, und jeder, der davon getrunken, lobt es. Ein Beweis, daß die Leipziger einen feineren Geschmack haben, als Ihr groben Merseburger. Und so mir Gott befohlen. Van Smiten.“
In Marseille errichteten 1671 einige Privatpersonen ein Kaffeehaus, das nahe bei der Börse lag. Dort traf man sich, rauchte Tabak, sprach von Geschäften, spielte und vertireb sich die Zeit. Nach acht Jahren entspann sich unter den Ärzten ein Streit über Nutzen oder Schädlichkeit des Kaffeegenusses; Doktor Columb in Marseille sprach öffentlich im Saale des Rathauses gegen die Neuerung. Man hörte ihm zu, kaufte seine Schrift und trank den Kaffee wie zuvor. In Paris hatte sich 1669 nach fast einjährigem Aufenthalt eines Abgesandten des Sultans, Soliman Aga, die neue Mode, Kaffee zu genießen, durchgesetzt. In Wien wurde 1683, in Nürnberg und Regensburg 1686, in Hamburg 1687, in Stuttgard 1712 ein Kaffeehaus eröffnet. Zweihundert Jahre ist es her, seit in Berlin öffentlich Kaffee getrunken wurde.
Die Kaffeehäuser, welche um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts in den größeren Städten des übrigen Europa entstanden, wurden meist mit schönen Tapeten bespannt, große Spiegel, Gemälde und Kronleuchter darin angebracht. Es gab dort Tee, Schokolade, Kaffee und andere Erfrischungen. Bald hörte man die gleichen Klagen wie vordem im Orient; die Kaffeehäuser galten als „Höhlen der Verschwenung und üppigen Genusses“. Und dazu kam es, daß diese Lokale aus politischen Gründen vorübergehend nicht geduldet wurden. In London erging unter Karl II. 1675 der Befehl, alle Kaffeehäuser sollten als „Stätten des Aufruhrs“ geschlossen werden. In Leipzig muß der braune Trank rasch beliebt geworden sein, denn im Jahre 1697 gab es dort schon so viele und darunter solch zweifelhafte Lokale, daß der Rat gegen die „ungebührlich eingeführte Tee- und Kaffeestuben“ einschritt, in denen „nicht nur über die in der kurfürstlichen Polizeiordnung bestimmte Frist Säfte geduldet, sondern auch zu verbotenen Spielen, Üppigkeit und anderen Lastern Gelegenheit geboten wurde.“
Ein Jahr zuvor hatten die Frauen Londons eine Eingabe an das Parlament gerichtet, in der behauptet wurde, daß die Männer viele Zeit in den Kaffeehäusern verbrächten und durch das neue Getränk an ihrer Gesundheit Schaden litten. Gelänge es nicht, diese verderbliche Gewohnheit abzuschaffen, so käme es gewiß bald dahin, daß die Nachkommen dieser Kaffeetrinker nur noch ein Geschlecht von Zwergen und Affen sein würden. Daraus geht hervor, daß die englischen Frauen jener Zeit noch keine Kränzchenschwestern waren, denen der Mokka schmeckte; offenbar tranken sie dafür Tee, der denn auch bei den Briten immer beliebter geworden ist. Die derbdeutsche Liselotte von der Pfalz, die Gemahlin des Bruders Ludwig XIV. Von Frankreich mochte den „modischen Plunder“ durchaus nicht. Sie schrieb im Jahre 1712: „Ich kann weder thé, coffé, noch chocolate vertragen, kann nicht begreifen, wie man das zeuch gern drinckt. Thé kompt mir vor wie heu und mist, coffé wie ruß undt feigbohnen, und chocolatte ist mir zu süß, was ich aber woll eßen mögte, were eine gutte kalteschal oder eine gutte biersupp. Mein gott, wie kan so was bitteres und stinkendes erfreuen, wie das coffé ist!“
Die Kaufleute dachten anders; in allen Staaten, die damals Kolonien besaßen, baute man den Kaffeebaum an und der Handel entwickelte sich zusehends. Große Summen für Kaffee floßen ins Ausland; Holland, Frankreich und England heimsten hohe Beträge ein. Im Jahre 1778 berechnete man im Fürstentum Lüneburg die Zahl der Kaffeetrinker mit vierzigtausend, von denen jeder täglich sechs Pfennige für Kaffee und Zucker ausgab, so daß, zwanzig Prozent für den Zwischenhandel abgerechnet, jährlich 240 000 Taler außer Landes wanderten. Aus dem kleinen Fürstentum Siegen gingen im Jahre 1781 allein für Kaffee und Zucker jährlich 180 000 Gulden nach Holland.
Mit der Verbreitung des Kaffeetrinkens hing es zusammen, daß verschiedene Handwerke in Tätigkeit gesetzt wurden, denn die türkische Art, den Mokka zu bereiten, wurde im Abendlande nicht ohne Änderungen übernommen. Zum Rösten oder Brennen der Bohnen benötigte man eine Kaffeetrommel; diese wurden von den Blechschmieden hergestellt, das Gestell, auf dem die Trommel ruhte, fertigten die Grobschmiede. Wenn man den gerösteten Kaffee anfänglich in einem Mörser zerstieß, so bürgerte sich doch bald die Kaffeemühle überall ein. Die geschickten Nürnberger Handwerksmeister erlangten für beide Erzeugnisse solchen Ruf, daß um 1784 Millionen dieser wichtigsten Apparate von dort ihren Weg über ganz Deutschland fanden. Man stellte aber auch Kaffeemühlen her, die bequem ins Reisegepäck, ja sogar in der Tasche untergebracht werden konnten. Um 1768 kostete eine kleinere Kaffeemühle für den Hausbedarf einen Reichstaler; größere, die für Händler bestimmt waren, erhielt man für die doppelte Summe. Wenn dies auch viel Geld war, so boten die Verfertiger dieser Mühlen doch zwei Jahre Garantie und versicherten, daß man sie zwanzig Jahre gebrauchen könne und sie nur alle drei Jahre schärfen müsse. Zum Kochen des gemahlenen Kaffees brauchte man eigenes Geschirr. Dann war ein Filterhut nötig, und bald gab es auch verschiedenartig konstruierte Kaffeekochmaschinen in einfacher und luxuriöser Aussstattung. Damit besaß man aber nur einen Teil der Einrichtung zur Bereitung des aromatischen Getränkes. Kannen und Tassen aus irdenem Zeug, englischer Erde, Steingut oder Porzellan bildeten die Sehnsucht der modischen Frauen; dazu kamen Kaffeelöffel aus Gold, Silber, Prinzmetall, Zinn oder Blech, und Kaffeekannen, die je nach Vermögen aus Silber, Messing, Zinn und Blech hergestellt zu haben waren. Weiteren Luxus trieb man mit Präsentiertellern, auf denen der Kaffee und das Kaffeezeug aufgetragen wurde. Man stellte sie aus Silber, Zinn, Kupfer, Messing und Holzeinlegearbeit her, und bezog Lackteller aus China und Japan, woher man auch kostbares Porzellan einführte. In bürgerlichen Kreisen begnügte man sich mit Präsentiertellern aus bemaltem und lackiertem Blech oder geflochtenem Stroh auf Holzunterlage. Als notwendig galten Kaffeebüchsen und Zuckerbehälter aus verschiedenem Material, und wer ganz nach der Mode gehen wollte, brauchte auch einen besonderen Kaffeetisch, der mit Decken von weißem, geblümtem Leinendamast oder buntem Kattun belegt wurde. Kaffeeservietten durften nicht fehlen, so wenig wie Zuckerzängchen aus Gold oder Silber. Dieser Luxus verlangte nach gebührender Schaustellung, und das Service fand seinen Platz auf dem Kaffeetisch, der Kommode oder einem Glasschrank.
Ein altes Wort: „Kleine Ursachen, große Wirkungen“ findet hier seine Bestätigung. Mit der Ausbreitung des Kaffeetrinkens begann ein zuvor unbekannter Luxus in allen Schichten Bedürfnis zu werden. Kein Wunder, daß man sich dagegen ereiferte. So erschien 1758 eine Schrift „über die seit geraumer Zeit ausgebrochene Kaffeeseuche“. Darin wird beklagt, daß diese „böse Gewohnheit schwer auszurotten sey“; daß diese Seuche die Zeit verderbe, die Faulheit vermehre, Armut und Mangel an Silber verursache, den Hochmut, Müßiggang und Verschwendung befördere und der Verleumdung beim Klatsch Vorschub leiste. Geld, das man gespart habe, verwandle sich nun in Silbergeschirr und werde so dem Umlauf entzogen.
Die neue Mode, im Hause Kaffee aufzutischen, führte zur Änderung in den Wohnungen. Seit es zum „guten Ton“ gehörte, daß die Hausfrau Kaffeebesuch annahm, wurden Besuchszimmer eingerichtet, die im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts noch in den wenigsten Häusern vorhanden waren. Wie J.G. Krünitz 1774 schrieb, mußte ein solches Zimmer da sein, wenn auch Werkstatt, Vorratskammer oder ein anderer Raum darüber schlecht verlegt werden sollte. Wohnungen, in denen eine solche Visitenstube fehlten, vermieteten sich schlecht. Mit der neuen Mode hing es aber auch zusammen, daß nicht nur die Visitenstube besser möbliert wurde, man trieb auch größeren Aufwand mit Kleidern. Krünitz sagt: „Die Kinder, heißt es, würden einem nachlachen, wenn man so angezogen käme, wie man vor einem Jahre geputzt erschien. So sehen jetzt die Visitenstuben aus, so ist es Mode, seine Besuche zu bedienen; so müssen wir es auch haben.“ Und so breiteten sich die Moden aus „wie die Pest“.
Das wäre aber noch nicht das Schlimmste. Durch die häufigen, in vielen Häusern täglichen Zusammenkünfte beim Kaffee entstünde Langeweile. Da man die Stunden nicht mit Stadtklatsch, mit Gerede über Wetter und Mode totschlagen könne, finge man an zu spielen, und zwar nicht zur Unterhaltung, sondern um Geld, wobei man nicht selten bis in die Nacht hinein säße.
Im Jahre 1781 berechnete der Hofrat Nikolaus Wachsmut in seiner Schilderung des „Unglücks, so die Coffeebohne in Teuschland angerichtet“, daß in einem Jahre vierundachzig Millionen Taler für Kaffee aus dem Reiche gingen. Wenn man davon für den Gewinn der Krämer und Fuhrleute zwölf Millionen abrechne, so blieben es immer noch zweiundfünfzig Millionen. „Durch zwanzig Jahre gerechnet, kommen 1440 Millionen Taler heraus; eine Summer, von der man kaum glauben sollte, daß sie in der Welt wäre.“ Krünitz schrieb: „Was wir für unsere heimischen Erzeugnisse von Fremden anschaffen können, das macht uns nicht arm; aber wir werden es, wenn wir mehr fremde Waren kaufen, als wir mit unseren Produkten bezahlen können.“
Bendenkt man, daß Deutschland im achtzehnten Jahrhundert im Vergleich mit anderen Ländern so gut wie keinen Seehandel besaß, dann kann man begreiflich finden, daß einzelne Staaten alles versuchten, um der weiteren Ausbreitung des Kaffeetrinkens möglichst große Schwierigkeiten zu bereiten. Das geschah nicht deshalb, weil man das Getränk für schädlich hielt, obwohl auch dies behauptet wurde, sondern um das Abfließen so großer Summen in das Ausland zu verhindern. Es kam da und dort zu völligen Verboten un anderwärts legte man hohe Abgaben auf den unerwünschten Kaffee, um dieser „Seuche und Raserei“ Einhalt zu tun.
Zahlreiche Schriften erschienen, in denen versucht wurde, die Menschen zu eigenem Nachdenken zu veranlassen; man wollte den Bürger und Landmann dahin bringen, selbst so klug zu werden, das allen so „höchste schädlichen Getränke“ abzuschaffen. Wenn man im Volksmund auch den bezeichnenden Ausdruck „Bankrottwasser“ erfand, so half doch alles nichts. Man trank die „Lotterbrühe“ weiter. So schrieb man 1784: „Der größte Teil der Bürger ist unfähig, die politischen Beweggründe der Gesetzgeber einzusehen, und es ist unmöglich, die Begriffe von Tausenden durch eine Verordnung auf einmal umzustimmen. Die Leute haben von Patriotismus gar keinen Begriff. Sie sagen: ,Laßt doch den Holländer, Franmann und Briten unser Geld für den Kaffee nehmen, was kümmert das uns, wenn wir ihn trinken können.' Man sagt sich, wie kann etwas seit gestern zum Verbrechen werden, was vorgestern noch erlaubt gewesen ist? Man beruhigt sich, gegen das Gestz zu handeln, ja man schlürft den verbotenen Kaffee mit dem stolzen Gefühl, daß man die beleidigten Rechte der Menschheit räche und sich den willkürlichen Verordnungen despotischerBeherrschung entziehe.“
Solche Stimmungen verstehen wir heute besser, als dies vor 1914 möglich gewesen wäre. Und wir wissen, was der Schleichhandel bedeutet und wozu Menschen fähig sind, die ihn betreiben.
In Hessen-Kassel war 1766 ein umständliches Verbot gegen den „Gesundheit und Vermögen schädigenden Trank“ erlassen und später noch verschärft worden. Andernorts kam es zu „Kaffeeschlachten“. In Panderborn rückten die Soldaten des Fürstbischofs ein, um die Bevölkerung für eine auf offenem Markte trotz des Verbotes veranstaltete Kaffeekneiperei zu strafen. Das Ende war, daß Bürger und Soldaten aus einem Topf Kaffee tranken.
In Hildesheim war 1780 verordnet worden: es solle kein Geld mehr für Kaffee ins Ausland geschickt werden. „Alle Töpfe, vornehme Tassen und gemeine Schälchen, Mühlen, Brennmaschinen, kurz alles, wozu das Beywort Kaffee zu gesetzt werden kann, soll zertrümmert werden, damit dessen Andenken unter unserem Volke vernichtet sei. Wer sich untersteht, Bohnen zu verkaufen, dem wird der ganze Vorrat confiscirt; und wer sich wieder Saufgeschirre dazu anschafft, kommt in den Kasten.“ Das heißt, er wird eingesperrt.
Im Fürstentum Nassau nahm der Kaffeeverbrauch, besonders auch bei den Landleuten überhand. Da kam 1782 eine „Neue Kaffeeverordnung“ heraus, nachwelcher nur in sechs Städten Kaffee verkauft werden sollte; im übrigen Lande war das „Feilhalten, Verkaufen, Vertauschen, Verborgen und Parthieren“ von Kaffee, gleichviel ob roh, gebrannt oder gemahlen, gänzlich verboten. In den Städten durfte nicht weniger als ein Pfund verkauft werden. Verborgte ein Händler Kaffee, so konnte er den säumigen Zahler vor Gericht nicht belangen. Mit „Parthieren“ ist die gesellschaftliche Vereinigung mehrerer Personen gemeint, die Kaffee pfundweise einkauften und unter sich verteilten. Vergehen wider die neue Ordnung bestrafte man mit Konfiskation der Ware und zehn Gulden; im zweiten Falle erhöhte sich die Strafe aus zwanzig, im dritten auf dreißig Gulden. Wer zum dritten Male straffällig wurde, verlor das Recht, eine Krämerei oder Wirtschaft zu betreiben. Geschah es zum viertenmal, so blühte dem „Verächter der Landesordnungen“ ein Jahr Zuchthaus oder man verurteilte ihn zu öffentlicher Schanzarbeit in Ketten und Banden. Die sogenannten Schutzjuden verloren schon beim dritten Fall den Schutz und wurden aus dem Lande verwiesen. Fremde Juden und sonstige Hausierer unterlagen den gleichen Bestimmungen; konnten sie die Strafen nicht bezahlen, so traten Leibesstrafen an deren Stelle; nach deren „Applikation“ brachte man sie außer Landes. Wer einen Straffälligen anzeigte, erhielt die Hälfte der konfiszierten Ware und ebenso den halben Strafbetrag ausbezahlt.
Auch Friedrich der II. Nahm den Kampf gegen das „Teufelsgesöff“ auf, da der Verbrauch des Kaffees zu weit gingen. „Jeder Bauer und gewöhnliche Mensch habe sich daran gewöhnt, weil er überall zu finden sey, und dadurch werde unendlich viel Geld zum Lande hinausgejagt.“ Der König erklärte, er sei in seiner Jugend mit Biersuppe erzogen worden, mithin könnten die Leute ebenfalls dabei gedeihen. Und gesünder als Kaffee wäre Biersuppe ohnedies. Es kam zu einem Monopol. Von den Abgaben, die in Preußen für den Kaffee gefordert wurden, sollten dreihundert Invaliden versorgt werden. Zweihundert Invaliden wurden dazu bestimmt, dem Geruch oder anderen verdächtigen Anzeichen nachzugehen; sie durften in die Häuser eintreten, wo sie Unterschleife vermuteten. Diese im Volksmund „Kaffeeriecher“ genannten Invaliden erhielten monatlich sechs Reichstaler Gehalt und jährlich eine vollständige Kleidung von blauem Tuch samt Hut und Stiefeln. Auf der Brust trugen sie einen Schild.
Man sah damals schon die Unmöglichkeit ein, durch solche Mittel der „Seuche“ beizukommen. „Will man auf diese Weise dem Unfug steuern,“ klagte Professor Schlettwein 1781, „was für eine erschreckliche Zahl von Zollbeamten, Laurern und Visitatoren wird man aufstellen müssen? Welche Summen wird man für Leute, die für den Staat doch nur Müßiggänger sind, aufzuwenden haben?“
Eines kam dabei doch zustande; man suchte nach Ersatzmitteln für den verbotenen Kaffee. Man brannte Erbsen, Eicheln, Gerste und getrocknete Möhren. Schon 1750 verwendete man Roggen zur Herstellung eines kaffeeartigen Getränkes, neunzehn Jahre später kam die wildwachsende Zichorie, damals Kaffeewurzel genannt, zur Bereitung eines Ersatzgetränkes auf und erschien bald als „preußischer Kaffee“ im Handel. In Magdeburg entstand 1769 die erste Zichorienkaffeefabrik; 1841 gab es dort einundvierzig Betriebe, in denen zweieinhalbtausend Leute beschäftigt wurden. In Belgien und England übernahm man diese Einrichtung. Aus Belgien wurden 1845 bereits viereinhalb Millionen Pfund eingeführt; Frankreich verbrauchte zwölf Millionen Pfund davon; in Deutschland bestanden 1882 dreihundertvierzig Fabriken, in denen die Kaffeesurrogate hergestellt wurden. Im Jahre 1907 bezifferte sich für Europa der Gesamverbrauch solcher Kaffeesurrogate auf fünfundsiebzig Millionen Mark. Aber der Verbrauch von Bohnenkaffee steigerte sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt; Deutschland verbrauchte 1899 nahe an hundertvierundfünfzig Millionen kilo Kaffee im Werte von mehr als hundertsiebenunddreißig Millionen Mark.
Über die weltwirtschaftliche Bedeutung des Kaffees sind augenblicklich genaue Angaben nicht möglich. Wenig bekannt sein dürfte, daß Brasilien in der Hauptsache den Weltmarkt versorgt. Die Ernten dieses Landes sind bestimmend für die Preislage dieses sieghaften Genuß- und Anregungsmittels. Zurzeit erlaubt uns der Tiefstand unseres Geldes noch nicht, die Kaffeeeinfuhr zu steigern, da die Devisenbeschaffung für die Getreideeinfuhr weit wichtiger ist. Deshalb konnte die Regierung die völlig unbehinderte Einfuhr nicht freigeben. Mehr als je zuvor sind wir auf Surrogate angewiesen, und es wird noch lange währen, bis Bohnenkaffee zu erschwinglichen Preisen zu haben sein wird.
Erinnert man sich noch einmal der ernstlichen Bemühungen, die man im achtzehnten Jahrhundert für nötig hielt, um den Menschen beizubringen, volkswirtschaftliches Denken und Handeln zu vereinigen, so wird man zu dem trüben Schluß gelangen, daß es auch heute vielen nicht möglich ist, auf einen Genuß zu verzichten, dem Millionen unseres Volksvermögens zum Opfer fallen. Man wird sich nicht nehmen lassen, das teure „Bankrottwasser“ weiter zu trinken.